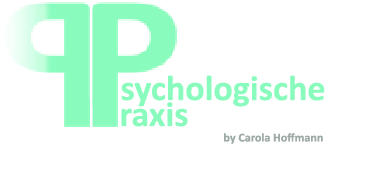Gesprächspsychotherapie
Was ist Gesprächspsychotherapie? – Begriffsklärung
Wenn von Gesprächspsychotherapie die Rede ist, fallen häufig auch die Begriffe Gesprächstherapie und klientenzentrierte Therapie. Wo liegt also der Unterschied zwischen diesen drei Begriffen? Es handelt sich bei diesen drei Namen nicht um unterschiedliche Verfahren, sondern um mehrere Begriffe für ein- und denselben therapeutischen Ansatz. Dieser personenzentrierte Ansatz wurde von dem Psychologen Carl R. Rogers (1902-1987) entwickelt. Er sah sein Verfahren als klientenzentriert und „non-direktiv“ an, was bedeutet, dass der Klient in erster Linie nicht aus der Perspektive des Therapeuten gesehen wird und nicht auf der Basis bestimmter störungstheoretischer Vorannahmen interpretiert wird, sondern dass er aus seinem eigenen Bezugssystem heraus verstanden wird – der Klient soll also in seinem Selbstverständnis nicht fremdbestimmt werden!

Prozess der konstruktiven Veränderung
Allgemein wird die Gesprächspsychotherapie als Bedingung für einen Prozess beschrieben, in dem es zu konstruktiven Veränderungen des Klienten kommt, die, wie es bei Rogers heißt, mehr Reife bedeuten oder mehr psychische Anpassung. Heute nennen wir das mehr psychische Gesundheit. Von welchem Menschenbild geht die Gesprächstherapie nach Rogers aus? Die Gesprächspsychotherapie wird zu den humanistischen Verfahren gezählt, deren Anliegen darin besteht, in der Theoriebildung, in Forschung und Therapie die Sonderstellung des Menschen zu beachten, die durch seine Sprachfähigkeit, seine Symbol- und Sinnbildungskompetenz sowie seine Möglichkeit zur Selbstreflexion und zu Wertentscheidungen zum Ausdruck kommt. Genauer gesagt beruhte Rogers Bild vom Menschen darauf, dass jede Person das Potenzial besitzt, sich aus sich selbst heraus zu entwickeln und zu reifen.
Daher besitze ein Klient auch alle Kenntnisse und Erkenntnisse, um sich selbst zu helfen. Alles für seine Heilung und Genesung Notwendige, das er bereits in sich trägt beziehungsweise seine eigenen individuellen Ressourcen, die er für sich nutzen könnte, sind ihm oft nur nicht bewusst oder nicht direkt greifbar.
Ausgehend von diesem humanistischen Menschenbild ist es die Aufgabe der Gesprächspsychotherapie, ein günstiges Klima für den Wachstumsprozess eines Menschen zu schaffen und einen Raum zu bieten, indem die Bedingungen für eine persönliche Weiterentwicklung erfüllt sind.
Was macht die Therapie aus?
Zunächst ist zu sagen, dass sie eine erlebenszentrierte, beziehungsorientierte und einsichtsvermittelnde Methode ist. Das heißt, dass das Erleben des Klienten im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und dass auch die Beziehung zwischen Therapeutin und Klient eine große Rolle spielt. Die Gesprächspsychotherapie gehört damit zu den Verfahren, bei denen die Förderung des Selbstverstehens gegenüber der Problembewältigung eine herausragende Rolle spielt (Grawe 1994, 2000). Im Mittelpunkt steht also die Person und nicht das Problem.
Selbstlösungskompetenz entwickeln
Das therapeutische Vorgehen ist dem jeweiligen Stadium des Therapieprozesses und den Bedürfnissen des Klienten, wie sie sich aus seiner Störung und seiner Persönlichkeit ergeben, angepasst. Mit dieser Adaptivität eng verbunden ist die Multiperspektivität, nach der der Therapeut je nach Erfordernis unterschiedliche Positionen einnimmt. Eine Perspektive, unter der sich der Therapeut auf ein Verstehen und Klären fokussiert, kann dann z.B. in eine solche der Ressourcenaktivierung oder der Förderung von Bewältigungskompetenz wechseln. Auf diese Weise lernen Menschen ihre eigenen zum Teil versteckten Ressourcen und Fähigkeiten zu nutzen, zu erweitern und selbst Lösungen für ihre Probleme zu finden.
3 Hauptwirkfaktoren der Gesprächspsychotherapie
Außerdem basiert die therapeutische Arbeit mit dem Klienten immer auf den 3 Hauptwirkfaktoren der Gesprächspsychotherapie. Diese Faktoren sind:
Verändern durch Anerkennen =
Veränderung auch im Sinne eines vertieften Selbstverstehens ist schon alleine durch bedingungsfreies Akzeptieren möglich.
Verändern durch einfühlendes Verstehens
Einmal akzentuiert durch Empathie und einmal durch das Erfassen von Sinngehalten. Hierbei geht es um das Erfassen eines zunächst noch verborgenen Sinns.
Kongruenz =
Der Therapeut sollte dem Klient als reale Person gegenübertreten und sich ihm transparent machen. Dabei wird die Unmittelbarkeit und Gegenwärtigkeit des Therapeuten gefordert.
Therapieverlauf
Entscheidend für den Verlauf der Therapie sind die Grundhaltungen des Therapeuten und des Klientes in der Interaktion, sowie deren Beziehung. Der Therapeut macht ein Beziehungsangebot und wenn der Klient dieses annimmt, dann stellen beide gemeinsam das psychologische Mittel eines kommunikativen Prozesses her, in dem der Klient wahrnimmt und damit auch annimmt, dass ihn der Therapeut bedingungsfrei positiv beachtet und akzeptiert. Außerdem sollte in der klientenzentrierten Gesprächstherapie der Klient als Ratsuchender stets im Mittelpunkt stehen und nicht die Methodik oder der Therapeut selbst. Eine solche mit positiver Wertschätzung und Achtung, sowie vorurteilsfreie Beziehung ermöglicht es dem Klienten sich zu öffnen und sich selbst besser zu verstehen und anzunehmen.
Ziele in der Gesprächspsychotherapie
Die konkreten Ziele der Therapie werden zwar auch in der Beseitigung von Symptomen gesehen, im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen jedoch jene Merkmale, denen eine wichtige Rolle bei der Verursachung psychischer Störungen zugeschrieben wird: Selbstablehnung und Selbstentwertung, Selbstverschlossenheit und Selbstentzweiung sowie Beziehungsstörungen. Angestrebt wird hier eine Verbesserung der Selbstannahme bzw. Der Selbstbejahung, der Selbsttransparenz und der Selbstübereinstimmung (Kongruenz) sowie der Beziehungsfähigkeit.
Dieser Informationsseite wurde von Pauline Jenal verfasst.